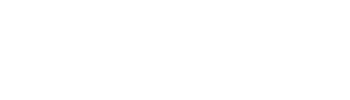Ausstellung „Produktive Region“ im „Klassenzimmer der Zukunft“
Im Pavillon „Klassenzimmer der Zukunft“ auf dem Alice-Salomon-Platz öffnet am 24. Juni 2025, von 17 bis 19 Uhr, die neue Ausstellung „Produktive Region“. Sie präsentiert Visionen für einen zukünftigen Umgang mit natürlichen Ressourcen und läuft bis 13. September 2025.
Zu sehen sind Beiträge von Leon Bischinger, Daniela Danz, dem Gutsgarten Hellersdorf/Prinzessinnengarten Kollektiv & AG Hochbeete/Anwohner:innenbeirat „Zwischenräume“, Juliana Oliveira mit der ASH-Medienwerkstatt, Sandra Schäfer, Metin Yilmaz, dem ZALF Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung und Schulgärten aus Kreuzberg, Hellersdorf und Bernau.
Jenseits von messbaren Faktoren bei der Ermittlung von Produktivität wie CO₂-Ausstoß, Energieverbrauch, Ertrag und Wertschöpfung fragt die Ausstellung: Welchen Beitrag können Co-Existenz, Gastgeber:innenschaft, Lebensbiografien und soziale Identität zur Bemessung einer regionalen Produktivität beisteuern? Nur industriell-technologische Maßstäbe zu betrachten und menschliche Faktoren außer Acht zu lassen, übersieht regionale Realitäten und führt zunehmend zu gesellschaftlicher Unzufriedenheit. Diese beeinflussen die Verhältnisse zwischen „Mensch und Mensch“, „Mensch und Natur“, „Land und Stadt“, „Produzent:in und Konsument:in“ und somit die Produktivität.
Die Ausstellung bringt drei Gegenden zusammen, die administrativ, medial und sozial üblicherweise getrennt voneinander behandelt werden: Kreuzberg, Hellersdorf und Ostbrandenburg. Naturräumlich betrachtet eint diese drei Gegenden vieles: Geologie, Klima, Boden, Hydrologie, Gewässer und Vegetation. Auch teilen sie Erfahrungen als Peripherien: Hellersdorf als städtische Peripherie, Ostbrandenburg als ländliche Peripherie und Kreuzberg als Westberliner Peripherie während des Kalten Kriegs. Die Nachkriegsbrachflächen von Kreuzberg boten bis zum Mauerfall viele experimentelle Freiräume für Kunst, Soziokultur und Urban Gardening: Das in der Ausstellung gezeigte Foto des ersten Spatenstichs von Osman Kalin für seinen Garten auf einer Brachfläche am Bethaniendamm in Kreuzberg 1983 von Metin Yilmaz markiert die Anfangszeit des Urban Gardening in Berlin. Als diese Freiräume nach 1990 peu à peu unter Druck gerieten, fanden einige Kreuzberger Kulturmacher:innen neue Standorte in Marzahn-Hellersdorf, z. B. beim Zirkus Cabuwazi, beim „prinzessinnengarten“ und der Kooperationspartnerin von „Zwischenräume“, die „neue Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK)“.
Eine weitere geteilte Erfahrung von Kreuzberg und Hellersdorf ist die starke Präsenz von Deutsche Wohnen auf dem Wohnungsmarkt. Wohnstandorte wie „Neues Kreuzberger Zentrum“ und Hellersdorf-Nord, die in den 1990er-Jahren von manchen CDU-Politikerinnen am liebsten abgerissen worden wären, sind mittlerweile profitabel. Die Kreuzberger Mietergemeinschaft „Kotti & Co“ setzt sich seit 2011 gegen profitorientierte Großwohnkonzerne wie Deutsche Wohnen ein. Die Aktivitäten von „Kotti & Co“ kommen auch Mieter:innen in Hellersdorf zugute, der Dialograum ihres Gecekondu-Hauses am Kottbusser Tor war eine Inspiration für die nGbK-Mitglieder zum Erwerb des Pavillons „Klassenzimmer der Zukunft“ 2022.
Das „prinzessinnengarten Kollektiv“ aus Kreuzberg ist international bekannt als Vorreiter des Urban Gardening in Deutschland. Entstanden am Moritzplatz und seit 2020 auf dem „Neuen Friedhof St. Jakobi“ in Neukölln. Seit 2016 betreibt das Kollektiv einen zweiten Standort in Hellersdorf. Ihr „Gutsgarten Hellersdorf“ ist ein Gemeinschaftsgarten am Rand des ehemaligen „Gut Hellersdorf“, zehn Minuten zu Fuß vom Alice-Salomon-Platz. Bis 1920 gehörte das Gut zu Brandenburg. Zu DDR-Zeiten wurden hier im Chicorée, Milch und Gemüsepflanzen produziert. 2016 übernahm das städtische Wohnungsbauunternehmen GESOBAU die Verantwortung für den Umbau des Gutshofs. Seit der Baufeldfreimachung 2020 stehen die Gutsgebäude leer. Das Areal macht die regional-kulturellen Verbindungen zwischen Hellersdorf und Ostbrandenburg sichtbar, dessen frühere Produktivität setzt ein Kreuzberger Kollektiv und die lokale Anwohner:innenschaft im Kleinen fort.
Für die Ausstellung „Produktive Region“ veröffentlicht das „prinzessinnengarten Kollektiv“ zum ersten Mal ihr Nutzungskonzept für das Gut als „Campus für Urbane Landwirtschaft und Nachhaltigkeit“. Vorgeschlagen wird eine Umwandlung des leeren Gutsgeländes in einen gemeinschaftsstärkenden, innovativen Lern- und Produktionsort, mit nachhaltigem „low-tech- und „low-barrier“-Anbau und Permakultur, mit Hofladen und Café, mit Forschung und Bildung und einer Partnerschaft mit dem Wochenmarkt auf dem Alice-Salomon-Platz. Mit Anwohner:innen erprobt das Kollektiv einen Teil der Campus-Idee im Pavillon: Im „Community Greenhouse“ bauen Mitglieder des Anwohner:innenbeirats „Zwischenräume“ Obst- und Gemüsepflanzen an, die mit Licht und Wärme im Pavillon gedeihen sollen. Mit der Veröffentlichung des Nutzungskonzepts möchte die Ausstellung sich stark machen für eine Aufnahme des „Campus für Urbane Landwirtschaft und Nachhaltigkeit“ in das aktuelle Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) HelIe Mitte der Bezirksverwaltung.

“Salon” von León Bischinger, seit 2024 Foto: station urbaner kulturen‹ der neuen Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK)
Auch der Ausstellungsbeitrag von Leon Bischinger verfolgt den Ansatz von niedrigschwelliger Gemeinschaftsstärkung. Mit seinem Kunstprojekt „SALON“ möchte er „Formate entwickeln, die aktuellen gesellschaftlichen Spaltungstendenzen entgegenwirken und demokratiefördernde, gemeinschaftsstiftende und politisch-soziale Wirksamkeit in ruralen Milieus entfalten“. Mit seiner für experimentelle Musik-, Koch- und Kunstsalons aufbereiteten Gulaschkanone kehrte er 2024 vom städtischen Kunststudium ins ländliche Ostbrandenburg zurück. Seine künstlerische „Feldküche on Tour“ markierte von Mai bis August ländliche Kulturräume in seiner Heimatgegend neu, wo aktuell viele Veranstaltungsformate stark von der AfD instrumentalisiert werden. Leon Bischingers Projekt versucht, ein „Nebeneinander von Unterschiedlichkeiten“ auszuhalten, um einen informellen Dialog über die Unzufriedenheit seiner Generation zu führen. Für „Produktive Region“ wird die „SALON“-Gulaschkanone vom Anwohner:innenbeirat genutzt, um einen Dialograum zwischen Hochschule und Wochenmarkt zu öffnen.
Als Teil ihrer künstlerisch-performativen Arbeit hackt Juliana Oliveira immer wieder Holz. Mit ihrer Performance „Wieder Gut“ setzt sie dem zerstörerischen Bild des Hackens einen umsichtigen, sorgfältigen Akt des Versöhnens mit der Natur entgegen. Bei der Performance baut sie einen drei Meter langen Baumstamm minutiös wieder zusammen, den sie zuvor mit Kettensäge und Äxten selbst zerlegt hat. Die Medienwerkstatt der ASH Berlin erstellt eine Videodokumentation für die Ausstellung.
Der Kurzfilm „Into the Magnetic Fields“ von Sandra Schäfer zeigt die Widersprüchlichkeit vom Einsatz von Technik und Wissenschaft in der Natur. Obwohl wir mit Technik und Wissenschaft für uns und für die Natur sorgen möchten, werden wir übergriffig und zerstörerisch. Im Film stört die Nachtkamera des Naturschützers die Tiere, trotz Versteck und Sorgfalt. Der von “Künstlicher Intelligenz“ durch Wellen und Signale gesteuerte Großfeldtraktor ist effizient und fortschrittlich, gleichwohl vernichtet er Kleinbauer_innen und Artenvielfalt.
„Berichte aus der zentralen Provinz“ nannte die Autorin Daniela Danz ihren Vortrag im Januar 2025 an der Humboldt-Universität zu Berlin. Grundantrieb ihres Schreibens ist für sie die Aufarbeitung ihrer ostdeutschen Biografie. Als ländliche Regionen in Ostdeutschland nach der Wende durch massenhafte Arbeitslosigkeit und Abbau der bis dahin gut funktionierenden Infrastruktur „doppelt bestraft“ wurden, war die Autorin im ländlichen Thüringen in einem Alter, „in dem ein Mensch oft die Grundfragen seiner geistigen Existenz entwickelt.“ Daniela Danz sieht das Landleben heute geprägt von „der Hoffnung der Einen auf einen neuen Anfang und die Enttäuschung der Anderen, die weggehen, weil sie zunehmend marginalisiert werden.“ Mit dem Klimawandel erlebt das Land eine weitere Bestrafung: Wo vor ein paar Jahren Daniela Danz „durch den Schatten des Waldes lief“, liegt jetzt „der Wald waagerecht aufgestapelt (…)“. Die Blumen gibt man zuerst auf, die jungen gesunden Bäume erhält man noch, die mickrigen überlässt man sich selbst und der Trockenheit.“
Den gesellschaftlichen Herausforderungen des Klimawandels im ländlichen Raum entgegnet das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg mit experimentellen Anbaumethoden, neuen Technologien, computergestützten Modellen und sozioökonomischen Ansätzen, verbunden mit Austausch, Vermittlung und Lehre. In ihrem „patchCROP Reallabor für mehr Vielfalt in der Landwirtschaft“ in Tempelberg begegnen sich Bäuerinnen und Bauern, Wissenschaftlerinnen und Politikerinnen bei Anbauexperimenten auf neu angelegten Feldeinheiten mitten in ehemaliger LPG-Landschaft. ZALF liegt auf der sogenannten „Innovationsachse Berlin-Küstrin“, der „Hauptstadtregion“ aus dem Koalitionsvertrag 2023 – 2026 der aktuellen Berliner Regierung.
Inspiriert von diesem produktiven Handeln lädt die Ausstellung Mitte Juli Schulen aus Kreuzberg, Hellersdorf und Bernau zu einem Reallabor Schulgarten auf dem Alice-Salomon-Platz ein. Dabei präsentieren die „Schule am Rosenhain“, die „Nürtingen-Grundschule“ und die „Tobias-Seiler-Oberschule“ ihre Ernte bei einer Schulgarten-Show auf dem Wochenmarkt. Sie berichten, wie sie mit den aktuellen klimatischen Bedingungen umgehen und was der Garten für die Schulgemeinschaft bedeutet.
Der Pavillon ist Teil des Standortes station urbaner kulturen der neuen Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK) in Hellersdorf. Hier bietet die nGbK Anwohnenden, Künstler:innen, Schüler:innen und Studierenden einen temporären Raum für Aktivitäten. 2025 und 2026 stellt die nGbK der Alice Salomon Hochschule (ASH) den Pavillon zur Verfügung. Von April bis Oktober 2025 wird im Pavillon das Ausstellungsprogramm „ZENTRUM zwischen Land und Stadt“ des ASH-Projekts „Zwischenräume“ veranstaltet. Die Projekte „Community Spaces“, „Zwischenräume. Belebung von Campus und Stadtteil“ und „Transferale“ sind Teil von „Transfer-Hub im Campus-Transferale (CaT)“ an der Alice Salomon Hochschule Berlin von 2023 bis 2027.
Die Aufstellung des nGbK-Pavillons auf dem Alice-Salomon-Platz wird vom Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen unterstützt.